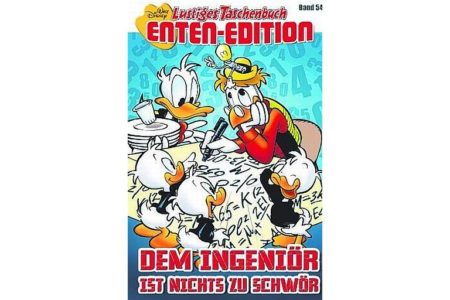„Elon Musk ist eine Lichtgestalt“
Führung: Gea-Group-Chef Stefan Klebert äußert sich im Interview zu seinem Berufsweg, seinem Selbstverständnis als Manager, seinem Umgang mit Niederlagen und zur Frauenquote.

Foto: Gea Group
VDI nachrichten: Die Gea Group arbeitet mit dem Pharmakonzern Pfizer zusammen, das zusammen mit Biontech einen Corona-Impfstoff entwickelt hat. Welchen Beitrag leistet Gea in diesem Zusammenhang bei der Pandemiebekämpfung?
Klebert: Gea ist unter anderem einer der wichtigsten Ausrüster der Pharmaunternehmen weltweit. Wir haben verschiedene technische Anlagen für die Medikamenten- und Impfstoffherstellung, unter anderem Separatoren und Homogenisatoren, also Prozessanlagen, in denen Flüssigkeiten in einer bestimmten Temperatur bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit verweilen. Außerdem gibt es eine Technologie von uns, die sogenannte Lyophilisierungstechnologie, bei der unter Vakuum die Temperatur abgesenkt wird und aus einer Flüssigkeit dadurch ein Pulver wird, das sehr lange haltbar ist und transportiert werden kann. Dieses Verfahren wird sehr oft angewendet für Medikamente oder Impfstoffe, die normalerweise eine Kühlkette brauchen. Unter Vakuum wird aus der Flüssigkeit Dampf. Und zurück bleibt ein Pulver ohne jegliche Bioaktivität. Allerdings muss man dazu sagen: Der erste Biontech-Impfstoff muss bei minus 70 °C Grad gekühlt werden, derzeit kann man die Kühlkette nicht umgehen.
Sie haben eine Ausbildung als Berufspilot und Fluglehrer, sind aber kein hauptberuflicher Pilot. Warum nicht?
Das hat eher Hobbycharakter bei mir. Mich hat die Fliegerei einfach begeistert, und dann wollte ich es richtig können. In jugendlichem Leichtsinn habe ich vor vielen Jahren beschlossen, die Ausbildung parallel zu meinem Beruf zu machen. Das habe ich auch geschafft. Zeitweise bin ich zum Spaß als Freelancer bei einer kleinen Airline als Pilot geflogen, habe aber nie mein Geld damit verdient.
„Wenn Sie was erreichen wollen, dann müssen Sie ein überdurchschnittliches Maß an Engagement einbringen, sonst geht es nicht.“
Kommen Sie aus einem Haushalt, wo Ihr Lebensweg als Ingenieur vorgezeichnet war?
Klebert: Eigentlich gar nicht. Mein Vater war Beamter, der hatte mit Handwerk und Technik überhaupt nichts zu tun. Bei uns hat zu Hause eher immer meine Mutter die Nägel in die Wand gehauen, wenn etwas zu machen war, oder natürlich ich, als ich etwas älter war. Aber offensichtlich hatte ich schon immer ein gewisses handwerkliches Talent. Ich habe schon als kleiner Bub viel gebastelt. Mit 15 Jahren habe ich aus einem alten Rasenmäher ein Motor-Gokart gebaut. Damit wurde ich in den Weinbergen erwischt, da gab es dann Ärger.
Jetzt sind Sie kein kleiner Bub mehr und haben als Manager eine beeindruckende Karriere hingelegt. Würden Sie sagen, Sie sind ein ehrgeiziger Mensch?
Bin ich sicher. Ich glaube, das gehört dazu. Wenn Sie was erreichen wollen und eine Tätigkeit ausüben wollen, dann müssen Sie ein überdurchschnittliches Maß an Engagement einbringen, sonst geht es nicht. Aber das ist nicht alles. Man muss Spaß haben: an der Aufgabe, am Produkt, das man vertritt, am Unternehmen. Und man muss auch Menschen mögen, wenn man so eine Position ausfüllen will.
Können Sie sich an Ihren ersten Job erinnern, als Sie zum ersten Mal als Ingenieur tätig waren? Mit welchem Gefühl sind Sie da eingestiegen?
Ja, das war bei der Firma Festo. Schon im Studium hatte ich viel Kontakt zu Festo und habe als Student in den Semesterferien dort gearbeitet. Ich denke gern daran zurück, denn ich hatte in den ersten Jahren einen sehr prägenden und charismatischen Chef. Das hat mir sehr geholfen. Wenn ich gefragt werde, wie man Karriere macht und was wichtig ist, dann sage ich immer: Ihr müsst euch nicht nur die Firma aussuchen, sondern vor allem auch den Chef. Das ist ganz wichtig. Wo kann ich etwas lernen, wo kann ich etwas abgucken. Das hat mich sehr geprägt.
Der Hobbypilot hat auch schon eine berufliche Bruchlandung erlebt
Gab es denn auch mal eine Bruchlandung in Ihrer beruflichen Laufbahn?
Ja, die gab es auch. Ich war CEO der Firma Nordex und bin dort nach sechs Wochen raus. Viele Dinge waren ganz anders, als man mir erklärt hatte. Und wir hatten dann einfach unterschiedliche Auffassungen. Daraus habe ich gelernt, dass man sich zum einen wichtige Entscheidungen im Vorfeld sehr gut anschauen, zum anderen aber auch lernen muss, dass man sich nicht immer auf alle Menschen verlassen kann. Das Dritte ist, dass man manchmal auch Entscheidungen treffen muss, ohne zu wissen, wohin sie konkret führen. Für mich war klar, das ist nicht mein Weg. Ich wusste nicht, was als Nächstes kommt. Aber es ging sehr gut weiter und ich habe es nie bereut, dass ich es so gemacht habe.
Wie gehen Sie mit Rückschlägen und Niederlagen um?
Aufstehen, Staub abschütteln und weiterlaufen. Niederlagen kommen und man muss sie auch ein Stück weit als Normalität begreifen. Es geht jedem Menschen so. Da gibt es Tage oder Wochen, in denen hat man das Gefühl, es läuft überhaupt nichts. Man bringt nichts wirklich voran. Oftmals läuft nicht alles so, wie man es sich vorstellt, privat und beruflich. Dann kommt eine andere Phase und es läuft wieder. Das ist etwas, was man immer wieder sich vor Augen halten muss und sagen muss: Wenn es runtergeht, geht es irgendwann auch wieder rauf. Man muss einfach nur durchhalten.
„Das ist eben das Wesen der Wirtschaft: Es geht um Wettbewerbsfähigkeit“
In Ihrer Laufbahn mussten Sie immer wieder harte Einschnitte bekannt geben, die nicht so populär waren und durch die Mitarbeiter auch den Job verloren haben. Bereitet Ihnen das manchmal schlaflose Nächte?
Man hat in einer Funktion wie meiner eine sehr große Verantwortung. Der muss man sich bewusst sein. Steve Jobs hat mal gesagt: „If you want to be popular, sell ice cream.“ Das ist sehr vereinfacht, trifft aber den Kern. Man kann es nicht allen recht machen.
Man hat zuallererst als Unternehmenschef die Verantwortung, dass die Firma in zehn Jahren besser dasteht als heute, weil davon dann die allermeisten Menschen profitieren. Wenn es Situationen gibt, wo man weiß: Die Wettbewerbsfähigkeit ist nur zu erhalten und die Firma ist nur für die überwiegende Mehrheit der Menschen ein sicherer Arbeitsplatz, wenn man bestimmte Einschnitte macht, dann kann man die auch mit der notwendigen Überzeugung vertreten. Auch wenn man weiß, dass das für das einzelne Schicksal kein Trost ist. Man muss dann versuchen, die Situation für die Menschen, die nicht mehr bei der Firma bleiben können, abzumildern. Da haben wir in Deutschland eine sehr gute Kultur. Wenn es jemanden trifft, gehen wir mit solchen Menschen sehr sozial um und wir versuchen, den Schaden zumindest finanziell kleiner zu halten. Das ist eben das Wesen der Wirtschaft: Es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist ein großer Unterschied zwischen einem Unternehmen und einer Familie. In einer Familie gehört jeder dazu, da wird jeder mitgetragen. Das kann sich ein Unternehmen nur ganz bedingt leisten.
Wenn Sie von Verantwortung reden, die man als CEO manchmal auch allein tragen muss, gibt es da Parallelen vom Flugzeugcockpit zum CEO-Sessel?
Wenige. Fliegen läuft relativ standardisiert ab. Im Unternehmen sind die Vorgänge im Normalfall komplexer. Was man von der Fliegerei lernen kann: Bei Piloten gibt es das Fordec-Prinzip, das steht für: Facts, Options, Risks, Decision, Execution und Check. Das ist der Leitfaden, den man eingebläut bekommt, um im Notfall richtig zu agieren. Man checkt die Fakten und Risiken, aber dann müssen Entscheidung und Umsetzung kommen. Und ich muss prüfen, ob die Umsetzung funktioniert. Ansonsten ist ein Unternehmen deutlich komplexer als ein Flugzeug, weil ein Unternehmen immer auch ein kulturelles Konstrukt von Menschen ist.
„Auch eine Bundeskanzlerin kann es sich nicht leisten, eine Woche nicht in die Mails zu gucken.“
Was bedeutet Ihnen Teamwork?
Das ist ganz besonders wichtig. Ich habe in meinem Berufsleben die besten Erfolge erzielt, als ich eine Mannschaft hatte, die einfach super zusammengepasst hat. Das ist die größte und wichtigste Aufgabe eines CEOs: Leute zu suchen und zu finden, die zusammenpassen, sich ergänzen, auch eine gewisse Diversity ausstrahlen und wissen: Wo ist mein Platz, wo kann ich was beitragen?
Teamwork ist absolut notwendig. Es gibt wenige Ausnahmelichtgestalten auf der Welt, die allein in der Lage sind, Dinge massiv zu verändern. 99 % der Menschen sind darauf angewiesen, dass es ein Team gibt, in dem sie Qualitäten und Kompetenzen ergänzen können.
Wer wäre so eine Lichtgestalt? Fällt Ihnen da jemand spontan ein?
Aktuell ist Elon Musk oft in der Presse, den ich auch mehrmals persönlich treffen durfte. Er ist ein extremer Visionär und hat auf dieser Welt als Individuum viel bewegt.
Sie sind ein Topmanager. Kann man Ihren Job teilen? Ist es möglich, Jobsharing zu machen?
Das wird schwierig. In so einem Job ist es nicht möglich, Urlaub zu machen. Man kann in den Urlaub gehen und Dinge zurückfahren, aber: Sie nehmen die Aufgabe immer mit. Auch eine Bundeskanzlerin kann es sich nicht leisten, eine Woche nicht in die Mails zu gucken und zu sagen: Ich bin dann mal weg. So ist es als Topmanager auch. Von daher ist es nicht nur eine Frage von Teilzeit oder Vollzeit. Es ist ein Commitment. Wenn man so eine Aufgabe annimmt, ist es mehr als ein Job.
Klebert äußert sich anerkennend zur Bewegung „Fridays for Future“
Der Slogan von Gea lautet „Engineering for a better world“. Liegt Ihnen persönlich Nachhaltigkeit am Herzen?
Ja. Jeder wird mit Ja antworten. Aber ich möchte für mich in Anspruch nehmen, dass mir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Man hat als Unternehmer eine Verantwortung. Wir haben nur einen Planeten, auf dem wir leben können. Daran wird sich auch morgen nichts ändern. Vielleicht leben wir irgendwann mal auf dem Mars. Aber im Moment nur auf der Erde. Die ist schön, unheimlich reich und vielfältig. Es spricht alles dafür, dass wir diesen Planeten so erhalten sollten und wollen und es uns eigentlich auch leisten können, weil wir so viel Technologie und Wissen haben. Gerade für Ingenieure ist das eine besonders spannende Herausforderung, weil sie einen großen Beitrag leisten können.
Wie finden Sie die Fridays-for-Future-Bewegung? Wären Sie da mitgelaufen?
Wahrscheinlich nicht, weil ich nicht der Typ dafür war. Ich war auch früher nicht bei Demos dabei, glaube aber, dass es richtig und gut ist, dass die Jugend Sensibilität dafür entwickelt. Ich war letztes Jahr beim World Economic Forum in Davos dabei, da waren auch die FFF-Aktivisten. Es ist beeindruckend, wenn man junge Menschen sieht, die sich engagieren. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass junge Menschen teilweise sehr euphorisch und einseitig denken und viele Dinge in ihrer Komplexität noch nicht so wahrnehmen. Aber ich glaube, die Bewegung hat der Welt gutgetan, auch wenn sie in einzelnen Bereichen sicher etwas undifferenziert ist.
„Das Beste wäre, wir finden alle zu einer Normalität, wo es ausschließlich um die Qualifikation geht“
Wie denken Sie über die Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen?
Ich glaube, dass Diversity einem Unternehmen extrem guttut. Ich glaube auch, dass wir zu wenige Frauen in technischen Unternehmen haben. Wir haben auch zu wenige Ingenieurstudentinnen. Es gibt viele Frauen, die sagen, ich studiere lieber Medizin oder Jura statt einer Ingenieurwissenschaft. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Ob eine Frauenquote zielführend ist, da bin ich mir unsicher. Das Beste wäre, wir finden alle zu einer Normalität, wo es ausschließlich um die Qualifikation geht. Das muss das Ziel sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer im Vordergrund stehen haben: Eine Funktion muss optimal besetzt sein.
Die Frauenquotendiskussion ist oft geprägt von der Vorstellung, dass es Machtstrukturen gibt, die Frauen ausschließen. Ich empfinde das nicht so. Ich habe viele Bekannte und Freunde, die als CEO arbeiten, und ich stelle nicht fest, dass es an Bereitschaft fehlt. Für alle Topjobs, für die ich Kandidaten gesucht habe, seitdem ich hier bin, habe ich ausschließlich Headhunterinnen beauftragt. Immer mit dem Ziel: Bringen Sie mir gute Frauen. Aber selbst die Personalberaterinnen tun sich schwer, entsprechende Frauen zu finden mit dem gleichen Erfahrungshintergrund. Diesen Fakt darf man auch nicht verdrängen.
Wie kommt es, dass so wenige Ingenieurinnen und Ingenieure auf Vorstandsposten sitzen?
Ich glaube, wir haben heute mehr als vor 20 Jahren. Damals waren das in den meisten Dax-Konzernen Juristen oder Kaufleute. Heute gibt es viele Ingenieure oder Naturwissenschaftler an der Spitze von technischen Unternehmen. Ich glaube, Ingenieure haben eine gewisse strukturierte Art des Denkens gelernt. Darauf kommt es in diesen Topjobs an.
Sie haben ja selbst noch einen MBA gemacht, das heißt, Sie haben betriebswirtschaftliches Know-how. Das ist sicherlich Grundvoraussetzung als Ingenieur, als Ingenieurin, wenn man Karriere machen will, oder?
Ja, es ist sicherlich immer die Frage, wo man einsteigt. Ich habe direkt nach dem Maschinenbaustudium als Assistent des Vertriebsvorstands gearbeitet, also relativ technikfremd, auch wenn es ein technisches Unternehmen war. Während meines ganzen Berufslebens habe ich bei meinen Tätigkeiten viel mehr die kaufmännischen Elemente gebraucht. Ich habe nie konstruiert oder eine Blindleistung in einem elektrischen System errechnet oder eine Festigkeitsüberprüfung machen müssen. Wenn Sie als Ingenieur in die Entwicklungsabteilung oder Forschungsabteilung gehen, ist es sicher etwas anderes, da sind kaufmännische Dinge nicht so entscheidend. Ich kann aber jedem Ingenieur nur raten, sich da weiterzubilden, weil es am Ende bei jeder Firma darum geht, Geld zu verdienen.
Das ungekürzte Gespräch mit Stefan Klebert hören Sie in unserem Podcast „Prototyp“ von ingenieur.de und VDI nachrichten: