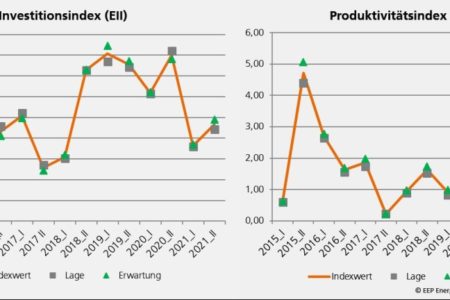Gerichtsurteil: Atommüll aus Jülich darf nach Ahaus
Der Atommüll stammt aus Jülich bei Aachen, er soll nach Ahaus – und dagegen gibt es seit 2017 eine Klage. Die kassierte das obersten NRW-Verwaltungsgericht in Münster jetzt.

Foto: imago/Ralf Rottmann/ Funke Foto Services
Im Forschungszentrum Jülich wurde früher intensiv an Reaktortechnologien geforscht, besonders am Versuchsreaktor AVR an Hochtemperaturtechnologien. Übrig geblieben sind knapp 290.000 kugelförmige Brennelemente in 152 Castoren. Die stehen dort seit Jahren in einem seit 2013 nicht mehr genehmigten Zwischenlager. Das wird geduldet. Seit 2016 gibt es eine Genehmigung, diese 152 Castoren nach Ahaus ins dortige Zwischenlager zu schaffen. 2017 folgte eine Klage dagegen (Aktenzeichen 21 D 98/17.AK), die wies gestern am späten Nachmittag der 21. Senat des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster nach einer mündlichen Anhörung ab.
Abgebrannte Brennelemente aus dem Forschungsreaktor Jülich dürfen also laut OVG im Zwischenlager Ahaus eingelagert werden. Die Kläger sind die Stadt Ahaus und ein Bürger, der rund 3 km vom Zwischenlager entfernt wohnt. Ob in Ahaus überhaupt eingelagert werden darf, dazu gab es früher Klagen, über die das OVG bereits 1996 und 2004 urteilte. Das atomare Zwischenlager in Ahaus ist bis Jahresende 2036 genehmigt.
Warum es mit dem Urteil zum Atommüll in Ahaus so lange gedauert hat
Die lange Verfahrensdauer begründet das OVG nach eigenen Angaben mit der Komplexität der Materie. Die Beteiligten hätten über die Jahre immer wieder um Zeit für Stellungnahmen in vielen Detailfragen gebeten. Stadt und Anwohner halten die geänderte Aufbewahrungsgenehmigung für rechtswidrig, weil besonders im Fall von Anschlägen oder dem Absturz von Militärmaschinen das Zwischenlager nicht sicher sei und so radioaktive Strahlung freigesetzt werden könnte.
„Die von den Klägern gerügten Ermittlungsdefizite der Genehmigungsbehörde liegen nicht vor“, urteilte das OVG. Vielmehr gebe es ein entsprechendes Gutachten des TÜV Nord, das als Anlage Bestandteil der Genehmigung sei. Die Freisetzung von Radioaktivität nach einem Flugzeugabsturz sei „zutreffend ermittelt“, und auch „etwaige Anschläge auf das Lager mittels Drohnen hat die Genehmigungsbehörde zutreffend berücksichtigt“, so das Gericht in einer Mitteilung. Das sieht die Initiative „.ausgestrahlt“, die selbst nicht geklagt hatte, nicht so: „Neuartige Gefahren etwa durch Drohnenangriffe sind nicht aus der Welt, bloß weil die Richter und Richterinnen des OVG die Augen davor verschließen. Das Zwischenlager Ahaus ist weder gegen Flugzeugabstürze noch gegen Angriffe mit modernen Waffen ausreichend geschützt.“ Den Klägern bleibt nur die Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.
Das Urteil kann das Problem der Zwischenlagerung nicht lösen
Danach dürfen also die Castoren von Jülich nach Ahaus transportiert werden. Von einem nicht mehr genehmigten Zwischenlager in ein noch genehmigtes Zwischenlager. Für diesen Transport aber liegt noch keine Transportgenehmigung vor. Jeder Transport von Castoren, die hoch radioaktiv strahlenden Atommüll enthalten, ist sehr aufwendig und birgt ein Gefahrenpotenzial. Damit der nicht unnötig durchs Land transportiert werden muss, gibt es das Konzept der regionalen Zwischenlager, die auch an den ehemaligen AKW-Standorten eingerichtet wurden.
Nur: Die Genehmigungen für diese Zwischenlager sind begrenzt. Das Lager im FZ Jülich ist sehr früh aus der Genehmigung, die meisten haben eine Genehmigung von 40 Jahren und diese läuft in den 2030er-Jahren, spätestens 2042 aus. Auch wenn Fachleute davon ausgehen, dass sich diese Genehmigungen geordnet verlängern lassen und Forschung aufgesetzt ist, um die Auswirkungen einer längeren Zwischenlagerung zu prüfen – für die Kommunen, in denen die Zwischenlager stehen, ist das eine kaum vermittelbare Hängepartie.
Kommunen mit Zwischenlagern werden alleingelassen
Hintergrund dafür, dass eine Kommune wie Ahaus selbst gegen ein Zwischenlager klagt, ist vielleicht nicht so sehr die Zwischenlagerung, sondern das Endlager. Inzwischen steht dafür ein Betriebsbeginn im Jahr 2100 im Raum. So lange müssten die Zwischenlager dann wohl mindestens bleiben. Und das alles, ohne dass den betroffenen Kommunen eine entsprechende Mitsprache – wie beim Endlagerstandort – eingeräumt worden wäre. Das stand in Münster am OVG nicht zur Debatte, zeigt aber die Metaebenen eines solchen Prozesses auf.