Warum auch Männer von geschlechtersensibler Medizin profitieren
Von wegen „Männergrippe“: Es gibt durchaus Unterschiede auf biologischer Ebene, wie Männer oder Frauen auf Erkrankungen reagieren. An der RWTH Aachen wird das genauer erforscht.

Foto: PantherMedia / HayDmitriy
Das will niemand erleben. Plötzlich starke Schmerzen in der Herzgegend, das Gefühl, der gesamte Brustkorb engt sich ein. Man bekommt kaum noch Luft, Übelkeit bis hin zu Erbrechen steigt auf, kalter Angstschweiß dringt durch die fahl gewordene Haut. So oder so ähnlich spielt sich ein Herzinfarkt ab. Allerdings zeigen eher Männer diese gemeinhin als typisch bezeichneten Symptome. Bei Frauen hingegen treten neben den Schmerzen im Brustkorb auch welche im Oberbauch sowie im Rücken auf. Hinzu gesellen sich Kurzatmigkeit und allgemein Erschöpfung.
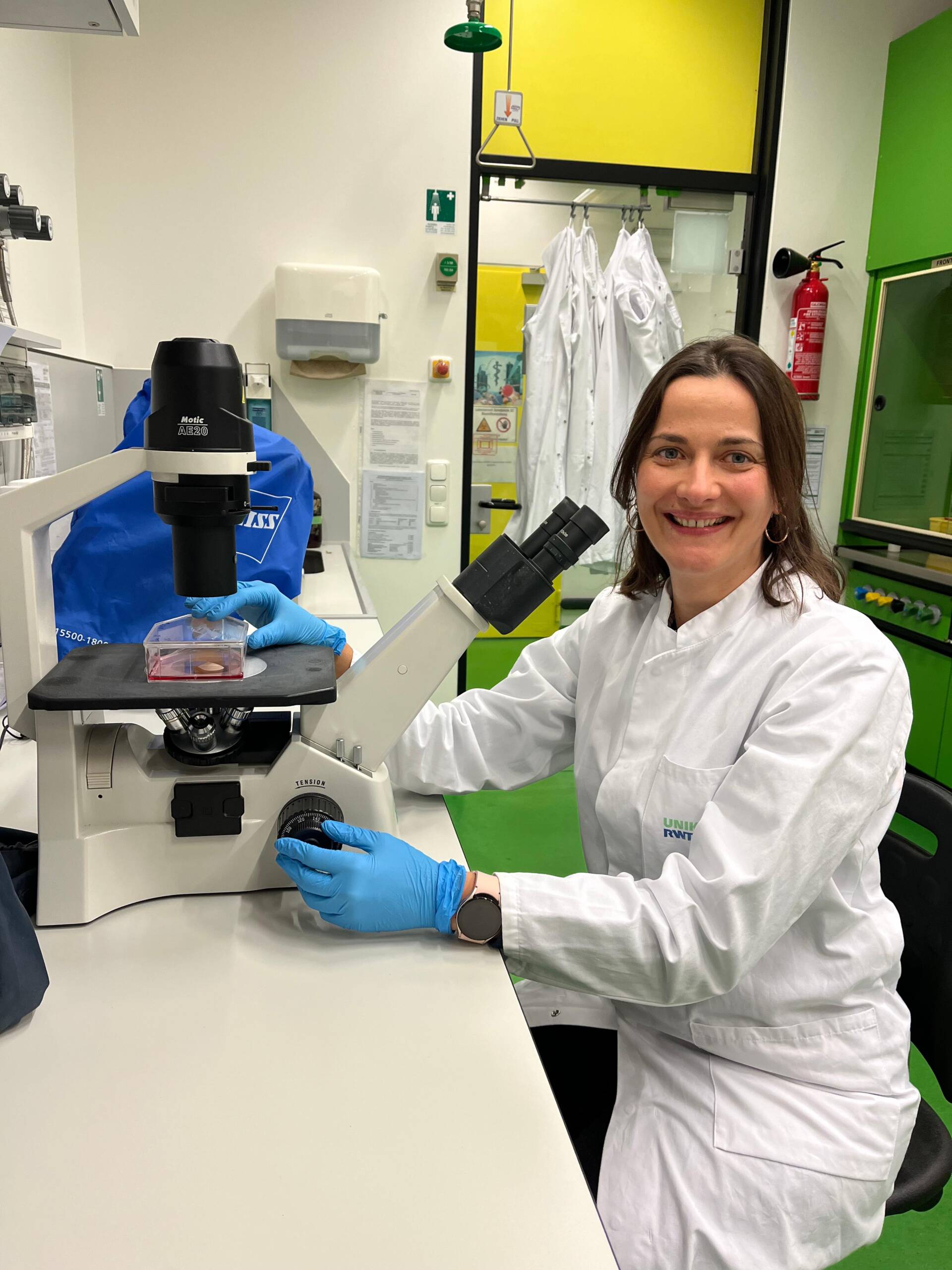
Neben solch handfesten Unterschieden in den Krankheitssymptomen gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern bis hinunter auf Zellebene. Wenn man diese besser erklären könnte, wäre eine geschlechtsspezifische personalisierte Medizin möglich. Daran forschen Elisabeth Zechendorf und Sandra Kraemer an der Uniklinik RWTH Aachen. In der Klinik für operative Intensivmedizin wollen sie die Grundlagen für eine Medizin schaffen, die den biologischen und soziokulturellen Unterschieden zwischen den Geschlechtern gerecht wird.
Männliche Zellen mit stärkeren Entzündungsreaktionen als weibliche
Bei Tierversuchen ist es üblich, sich hauptsächlich auf männliche „Probanden“ zu beziehen. „Üblicherweise sind 80 % der Versuchstiere in der Forschung männlich“, erklärt Kraemer. Dabei gäbe es gute Gründe, die Forschung auf männliche und weibliche Tiere auszuweiten und die Ergebnisse getrennt voneinander auszuwerten, argumentieren Zechendorf und Kraemer. „Es ist bekannt, dass männliche Zellen stärkere Entzündungsreaktionen zeigen als weibliche“, erklärt Zechendorf. Außerdem kommt es bei Frauen im Falle einer Blutvergiftung zu weniger schweren Verläufen. Darüber hinaus liegt die Sterberate hier niedriger als bei männlichen Patienten. Die Aachener Forscherinnen wollen nun aber keineswegs mit ihrer Arbeit Frauen bevorzugen, sondern eine Verbesserung in der Diagnose und Behandlung für alle bewirken.
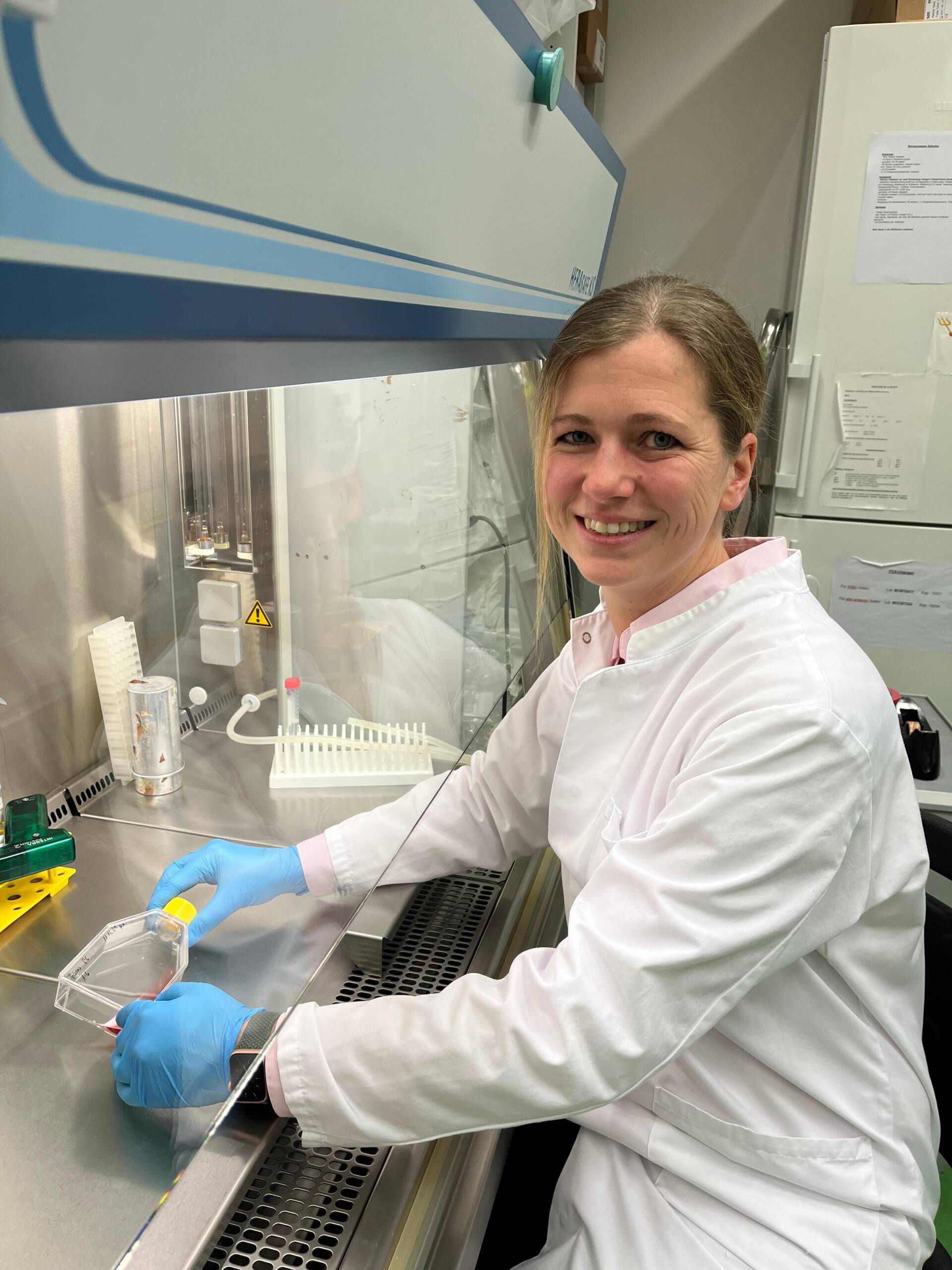
Hormone, genetische Faktoren und soziokulturelle Aspekte spielen eine Rolle
Warum eine Gleichbehandlung der Geschlechter in der Medizin fehl am Platze ist, machen die Forscherinnen an drei Faktoren fest. Erstens: Hormone wie Östrogen und Testosteron wirken unterschiedlich bei Entzündungen. So reagieren Frauen vor der Menopause besser auf Entzündungen als danach. Nach den Wechseljahren scheinen sie diesbezüglich mit Männern vergleichbar zu sein. Zweitens: Genetische Faktoren bewirken Unterschiede auf die Immunantwort bei Erkrankung. Und drittens: Soziokulturelle Aspekte wie Lebensstil, Ernährung und Stressbewältigung sind häufig geschlechtsspezifisch. Auch diese Faktoren wirken sich entsprechend unterschiedlich auf die Gesundheit aus.










