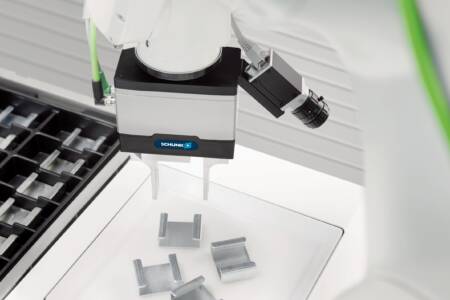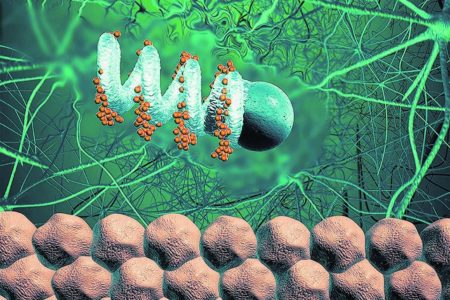Die Lebensdauer von Produkten wird geplant

Foto: Stone/Getty Images
Walther Rathenau, Industrieller und späterer Außenminister der Weimarer Republik, hatte bereits vor hundert Jahren formuliert, dass Markt und Mode ständig neue Bedürfnisse und somit schnelllebige „Verbrauchswerte“ erzeugen, „an die Stelle der Dauerhaftigkeit bequeme Erneuerung“ gesetzt werde und sich die „Wachstumsspirale“ zu einer endlosen „Vergeudungsspirale“ entwickele.
Die bekannten Probleme der Wegwerfgesellschaft scheinen nun im Lauf der digitalen Revolution neue Dimensionen zu erreichen. So verkürzte sich die Nutzungsdauer der PCs von acht bis zehn Jahren in den 1980er-Jahren bis zum Ende der 1990er-Jahre auf nur noch drei bis vier Jahre im privaten und zwei bis drei Jahre im gewerblichen Sektor. Handys und Smartphones wurden in den hoch entwickelten Ländern zunächst durchschnittlich zwei Jahre genutzt, inzwischen schaffen sich die Verbraucher bereits nach etwa einem Jahr ein neues Gerät an, in Japan sogar bereits nach einem halben Jahr.
Für Hans Dieter Hellige, Professor für Technikgestaltung und Technikgenese an der Universität Bremen, ist gar nicht so sehr die gewollte Obsoleszenz (Verschleiß) von technischen Produkten durch die Verwendung von wenig haltbaren Bauteilen oder die geringe Reparaturfähigkeit entscheidend, sondern der systemische Charakter der Obsoleszenz – vor allem bei IT-Produkten.
Gestützt auf mathematische Prognosemodelle wurden seit den 70er-Jahren neue Produktzyklen strategisch geplant, ja regelrecht getaktet. „Getrieben wurde die Politik schneller Produktwechsel durch die strategische Allianz von Intel und Microsoft, die beide den De-facto-Standard für IBM-kompatible PCs definierten und die Konkurrenz durch schnell aufeinander folgende Produktzyklen auf Abstand hielten“, konstatierte Hellige auf der Jahrestagung der VDI-Technikhistoriker vergangene Woche im Bergbaumuseum in Bochum.
Inzwischen hätten sich auch die Benutzer informationstechnischer Endgeräte und Anwendungen an das Prinzip „immer besser, immer schneller und immer billiger“ gewöhnt. Der Gebrauch bestimmter Smartphones als Ausdruck von Lifestyle und als Mittel zur sozialen Abgrenzung wird beispielsweise über kleinste Verbesserungen forciert oder vorgetäuschte Innovationen, die im Grunde nur aus verändertem Design bestehen.
Über die Software habe die Industrie nun neue Möglichkeiten, Bedarf zu erzeugen, betonte Frank Dittmann im gemeinsam mit seiner Kollegin Tina Kubot – beide sind Kuratoren am Deutschen Museum in München – ausgearbeiteten Vortrag. Stellten die Unternehmen keine neuen Updates bereit, werde automatisch Druck auf die Verbraucher erzeugt, sich nach kurzer Frist Ersatzgeräte anzuschaffen. Dies beträfe aber vor allem Privatkunden, im Industriesektor würden andere Faktoren eine Rolle spielen. Beispielsweise machen in der Medizintechnik Sicherheitsaspekte und damit verbundene juristische Verantwortungen eine geplante Obsoleszenz unnötig, wie ein Diskussionsteilnehmer anmerkte.
Was die Obsoleszenz bei Smartphones oder Tablet-PCs angehe, seien Prognosen sehr schwierig, erläutert Kubot. Zurzeit gebe es vereinzelt Anzeichen dafür, dass wieder Geräte mit längerer Lebensdauer angeboten werden, die sich durch den Austausch von Modulen auch vernünftig reparieren lassen, aber eine wirkliche Tendenz sei noch nicht zu erkennen.
Auf jeden Fall seien technische und gesellschaftliche Prozesse eng miteinander verknüpft, ergänzt Dittmann. „Die Leute bauen einerseits eine gewisse Beziehung zu ihrem Gerät auf, weshalb sie nicht gewillt sind, ständig neue Geräte zu kaufen. Andererseits geht es manchmal gar nicht um das Produkt als solches, sondern um ein Image, um die Zugehörigkeit zu einer Art Subkultur, wie bei der Apple-Community.“ Für diese Verbraucher stünden die Kosten gar nicht im Vordergrund.
Eine Reaktion auf den systemimmanenten schnellen Wechsel von Konsumgütern ist die Selbst-Reparatur, über die auf der Bochumer VDI-Tagung der Technikhistoriker Stefan Krebs berichtete. In den Feuilletons überregionaler Tageszeitungen häufen sich die Berichte über Reparatur-Cafés und Webseiten wie „I-fix-it“, die Anleitungen zum Selbst-Reparieren von technischen Geräten liefern.
Das erinnert Krebs an die Zwischenkriegszeit und auch an die 1960er- und 70er-Jahre, als das Selbst-Reparieren ebenfalls Konjunktur hatte. Die vom Konsumenten ausgeführte Reparatur „ist aber nicht nur Mittel zum Zweck der Aufrechterhaltung technischer Funktion, sondern oftmals auch Zweck an sich: Reparieren dient dann beispielsweise der Selbstvergewisserung, Identitätsstiftung und Gemeinschaftsbildung oder sie ist eingebettet in größere Sinnzusammenhänge, wie den Schutz der Umwelt und den Protest gegen die Wegwerfgesellschaft.“ Die Selbst-Reparatur könne daher auch als eine Strategie zur Wiederaneignung von Technik verstanden werden.