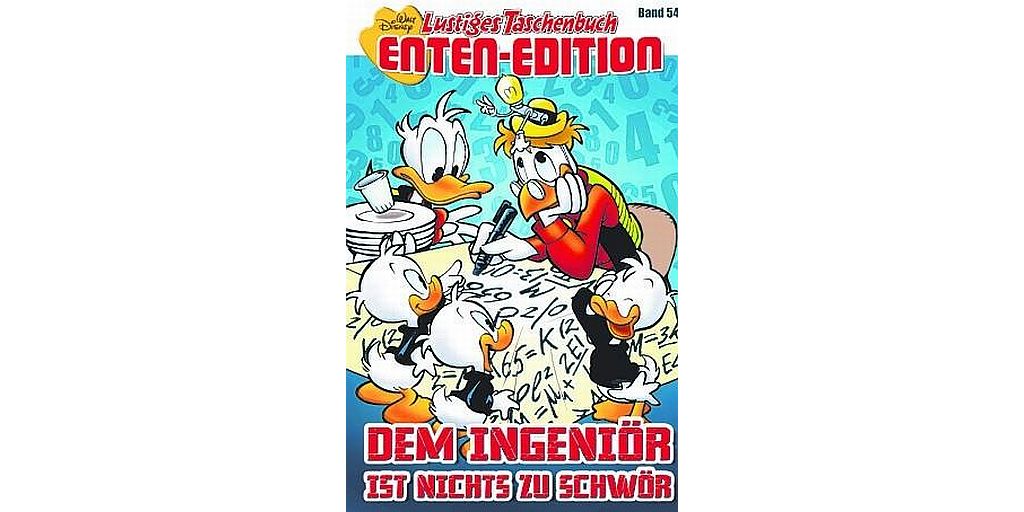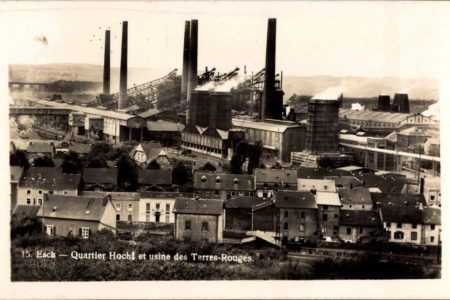Historikerkongress beschäftigte sich mit dem Wandel der Technikmuseen
Die Technikgeschichtliche Tagung des VDI analysierte Vergangenheit und Zukunft der Technikmuseen. Einst gegründet, um Meisterwerke der Technik auszustellen, präsentieren sie nun Sozialgeschichte.

Foto: Peter Steinmüller
Ralf Beil, Generaldirektor der Völklinger Hütte, hat ganz klare Erwartungen an das gigantische Industriedenkmal unter seiner Verantwortung: Es solle die Besuchenden „einsaugen“, sie sollten einen ganzen Tag dort zubringen. Dieses „Einsaugen“ funktionierte auf jeden Fall bei den rund 100 Teilnehmenden der Technikgeschichtlichen Tagung, die der VDI und die Georg-Agricola-Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur vergangene Woche erstmals gemeinsam abhielten. Historikerinnen und Ingenieure beschäftigten sich im gedämpften Licht der Erzhalle, die einst 12 000 t Eisenerz beherbergte, unter dem Motto „Technik.Geschichte.Vermitteln.“ mit den Veränderungen im Selbstverständnis von Technikmuseen und den Auswirkungen auf die Ausstellungen.

Heike Weber, Professorin an der TU Berlin und Vorsitzende des Interdisziplinären Gremiums Technikgeschichte des VDI, skizzierte in ihrer Einführung die Entwicklung der Technikmuseen: Die Sicherung des industriellen Erbes habe Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen unter kräftiger Beteiligung des VDI-Vorsitzenden Oskar von Miller. In den 1970er-Jahren sei unter dem Motto „Grabe, wo du stehst“ eine Basisbewegung entstanden, die Fabriken als Orte verstand, „wo früher die Maloche stattfand“ und die die Museen sozialgeschichtlich ausrichtete. Am Ende des 20. Jahrhunderts wurden die wegen des Strukturwandels stillgelegten Fabriken in Museen umgewandelt. Ein jüngerer Trend sei die „Eventisierung“ der Museumsarbeit etwa durch die Science-Center. Dort können sich Besuchende etwa mit Experimenten selbst einbringen.
Technikmuseen beschäftigten sich seit den 1970er-Jahren mit den sozialen Folgen
Wie der von Weber angesprochene Wandel im Selbstverständnis der Technikmuseen in den 1970er-Jahren ablief, schilderte beispielhaft Bärbel Maul, Leiterin des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim.
Damals seien von der Studentenbewegung beeinflusste Historiker bei ihrem Marsch durch die Institutionen in den Museen angekommen. Entsprechend wollte das Rüsselsheimer Museum nicht länger nur Industrie und Technik per se abbilden, sondern vor allem ihre sozialen Folgen. Das von der FAZ so geschmähte „Museum des kleinen Mannes“ zeigte die Bedingungen, unter denen die Menschen im dortigen Opel-Werk gearbeitet hatten. Fotos, Geschichten und Biografien holten die „Opeler“ (nicht „Opelaner“, wie Maul betonte) aus ihrer Anonymität.

Auf den Niedergang von Opel – 1976 zählte das Werk noch 58 000 Beschäftigte, jetzt sind es nur noch 9000 – reagierte das Museum mit einer Neuorientierung. Nun sollen die Veränderungen auf dem weltweiten Automobilmarkt fassbar gemacht werden. Maul verdeutlichte dies an einem Autositz, der ähnlich einer Explosionszeichnung in seine Einzelteile aufgelöst gezeigt wird. Zu jedem Element werden die Herkunft und sein CO2-Fußabdruck genannt.
Die Frage nach einer Betriebsanleitung für die Exponate löst bei mir regelmäßig schallendes Gelächter aus.
Jürgen Kabus
Leiter des Industriemuseums Chemnitz
Welche praktischen Folgen dieser Wandel der Industriearbeit für den Alltag der Museen hat, erläuterte anschaulich Jürgen Kabus, Leiter des Industriemuseums Chemnitz. Beispiel Arbeitsschutz: Die Frage nach einer Betriebsanleitung für seine Exponate löse bei ihm regelmäßig „schallendes Gelächter aus“. Auch sei er nicht bereit, an seinen historischen Maschinen den von den Vorschriften geforderten Not-Aus-Knopf zu installieren. Eine Möglichkeit, die Vorschriften trotzdem einzuhalten, sei die Leistung der Maschinen zu reduzieren. Auch gehe das Wissen über die Funktionsweise, Wartung und Reparatur der Maschinen verloren. Denn diese Aufgaben nehmen zum Großteil Ehrenamtliche wahr, die in ihrem Berufsleben an diesen Geräten gearbeitet hatten und nun aus Altersgründen immer weniger zur Verfügung stehen: „Unsere Jungen sind 60 Jahre alt.“ Hinzu kommt das Fehlen von Ersatzteilen, was Kabus an einer Schweißzelle verdeutlichte, die VW dem Museum geschenkt hatte. „Wir haben jetzt die letzten Ersatzteile verbaut. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in fünf Jahren noch die Schweißzelle in Funktion zeigen können.“
Museumsdirektor zählt einen Braunkohlebagger zu seinem Inventar
Die von Kabus genannten Herausforderungen nehmen bei Thorsten Hinz buchstäblich riesige Ausmaße an. Der Geschäftsführer des Bergbau-Technik-Parks in Großpösna bei Leipzig zählt zu seinem Inventar einen 1300 t schweren Schaufelradbagger sowie einen fast doppelt so schweren Absetzer, der den Abraum des Braunkohletagebaus abtransportierte. Allein für die Erneuerung des Anstrichs werden Tonnen an Farbe benötigt. Die Arbeit übernimmt teilweise die von Hinz sogenannte „Jugendbrigade“ ehemaliger Arbeiter aus Tagebau und einem nahe gelegenen Kraftwerk: „Der Jüngste ist 64.“ Mit der Zeit würden die Zeitzeugen immer weniger, ihr Wissen über den Umgang mit den Schwergeräten gehe verloren. Das habe auch Konsequenzen für die Besuchenden, denen bisher das riesige Schaufelrad des Baggers noch im Hilfsbetrieb gezeigt werden konnte.

Wie Augmented Reality zumindest teilweise die Vermittlung technischer Abläufe übernehmen kann, schilderte Mathias Wagener, Stellvertretender Museumsleiter des Schiffshebewerks Henrichenburg in Waltrop am Dortmund-Ems-Kanal. Im Maschinenhaus werden auf einer Stelle die dort einst installierten Dampfmaschinen, Pumpen und Dynamos eingeblendet, wenn Besucherinnen sie hin- und herschwenken. Markierungen auf den Fußbodenkacheln verdeutlichen die Dimensionen der Maschinen. Wagener zufolge zeigt diese Darstellung die historische Wirklichkeit besser als eine zuvor aufgestellte Pumpe, die dem Original ähnlich war. Dass sie tatsächlich nie im Maschinenhaus installiert war, sollte ihr neuzeitlicher Betonsockel verdeutlichen, was aber kaum ein Besucher kapiert habe.
Industriegeschichtliche Website nutzt Hörspiele und Graphic Novels
Stefan Krebs, Assistant Professor an der Universität Luxemburg, zeigte anhand der „Minett Stories“, wie Industriegeschichte multimedial auf einer Website vermittelt werden kann. Die Website minett-stories.lu über die Industrieregion wurde entwickelt, weil Esch-sur-Alzette in Luxemburg im vergangenen Jahr als Kulturhauptstadt Europas fungierte. Das Projektteam habe „keine klassische Hüttentechnikgeschichte“ präsentieren wollen, so Krebs. Vielmehr sollten der Alltag und die Geschichten der Menschen in der luxemburgischen Industrieregion im Mittelpunkt stehen. So findet sich auf der Website eine Graphic Novel über einen italienischen Bergmann, der in den 1920er-Jahren in Schwierigkeiten gerät, weil er sich in der Kommunistischen Partei engagiert, obwohl Ausländern politische Betätigung verboten war. Zwar ist die Figur fiktiv, wurde aber aus tatsächlichen Lebensgeschichten konstruiert. Ein Hörspiel, das sich auf Kriminalakten stützt, weckt die Erinnerungen an längst vergessene soziale Unruhen nach dem Ersten Weltkrieg.
Krebs räumte ein, dass sich die Absicht, vor allen Dingen jüngere Menschen mit der Website anzusprechen, nicht aufgegangen sei. Werden Social-Media-Kampagnen für die Website gefahren, ist die mittlere Verweildauer auf der Seite wesentlich geringer, als wenn über die klassischen Medien Hörfunk und Zeitung die Älteren mobilisiert werden. Wie gefährdet die Zukunft solcher Angebote ist, zeigt das Beispiel der App, die eingestellt werden musste, weil die Finanzierung ausgelaufen war. Das gleiche Schicksal droht der Website, wenn nicht noch ein Projektpartner sich bereit erklärt, sie weiter zu betreiben.

Die Zukunft ins Museum zu stellen, erscheint als paradoxes Unterfangen. Das Deutsche Museum in München hat sich trotzdem dieses Ziel gesetzt, wie Sebastian Kasper, Wissenschaftlicher Mitarbeiter dortigen Ausstellungsprojekts „Energie – Strom“, erläuterte. Die bereits seit 1953 eingerichtete Starkstromabteilung ist noch am ursprünglichen Zweck des Museums orientiert, „Meisterwerke der Naturwissenschaft und Technik“ zu zeigen. Entsprechend setzt sie Fachwissen voraus und verzichtet auf den Verwendungszusammenhang der Exponate.
Die neue Dauerausstellung soll 2028 starten und zeigen, dass das Stromsystem nicht rein technisch bestimmt wird, sondern Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse ist. Dass die Zukunft der Energieerzeugung und -versorgung voller Unsicherheiten ist, macht es den Historikern besonders schwierig, eine Ausstellung zu konzipieren, deren Inhalte für 15 bis 20 Jahre gelten.
Historiker entzaubert den Mythos der Reichsflugscheiben
Wie das Modethema „Wasserstoff“ dargestellt werden soll, wird etwa im Ausstellungsteam heftig diskutiert. Zu groß ist das Risiko, dass die Energiequelle der Zukunft bald wieder Vergangenheit sein wird. Doch im Wandel der Technikgesellschaft gibt es auch Konstanten: Über die Jahrzehnte war das Starkstromexperiment, bei dem Mitarbeiter im Faradayschen Käfig live einem Blitzeinschlag ausgesetzt wurden, für viele der Höhepunkt des Museumsbesuchs. Das Experiment wird auch in der neuen Ausstellung gezeigt.