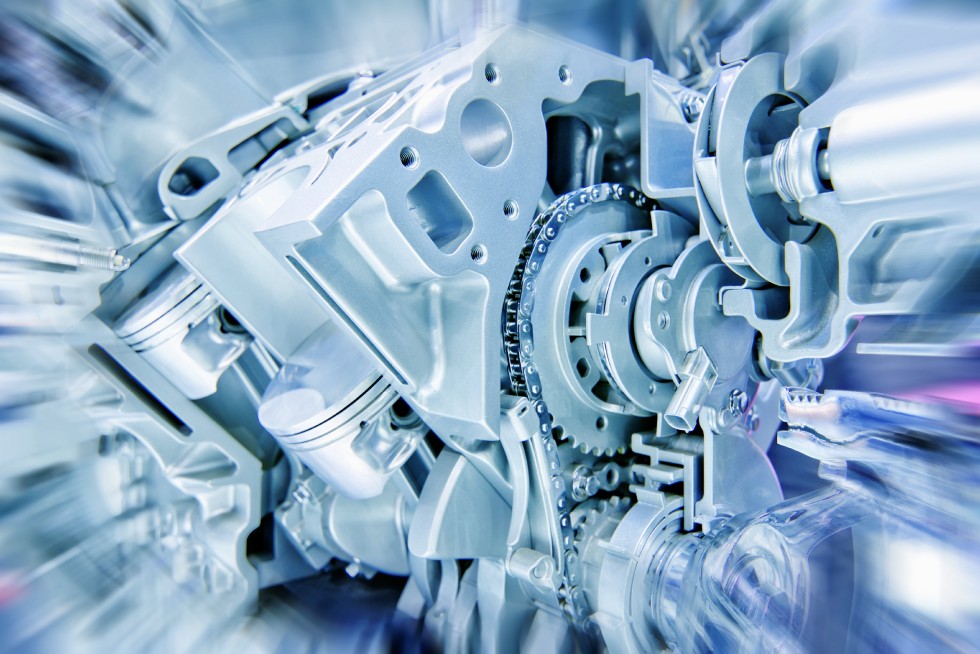Hilfe, wer sind eigentlich meine Aktionäre?
Die Zeit der anonymen Aktionäre könnte bald vorbei sein. Immer mehr deutsche Unternehmen wollen wissen, wer ihre Aktionäre sind. Sie stellen von Inhaber- auf Namensaktien um. Damit sollen Übernahmeversuche erschwert und die Transparenz verbessert werden. Doch das Problem sind die ausländischen Anteilseigner.
In der angelsächsischen Welt und in der Schweiz wissen die meisten Unternehmen, wem sie gehören. Fast alle Titel sind Namensaktien. In Deutschland ist es anders: Dort sind anonyme Inhaberaktien sehr stark verbreitet. Erst in den letzten Jahren haben sich Namensaktien auch hierzulande mehr und mehr durchgesetzt. Inzwischen haben die Hälfte aller Dax-Konzerne Namensaktien herausgegeben – von Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Allianz, Daimler, Bayer, K+S bis zu BASF. In der zweiten Reihe sind es etwas weniger. Laut Aktienregisterservice Adeus haben sich 21 der 50 MDax-Firmen und zehn der 50 SDax-Unternehmen mittlerweile für Namensaktien entschieden.
Diese führen also Aktionärsbücher, in dem sie die Besitzer ihrer Aktien registriert haben. Namen, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse und auch die Zahl der gehaltenen Aktien sind dort aufgeführt.
BASF begründet diesen Schritt mit dem Argument, so besser mit ihren Aktionären kommunizieren zu können. Ähnlich argumentiert auch der Düngemittelspezialist K+S. Die Umstellung auf Namensaktien ermögliche eine direktere Kommunikation mit den Anteilseignern und vereinfache den Anmeldeprozess und die Stimmabgabe bei der Hauptversammlung (HV).
Über die Namensaktien lassen sich die Aktionäre zielgerecht ansprechen, erklärt Klaus Schmidt, Geschäftsführer von Adeus. Die Namensaktionäre können per E-Mail zur HV eingeladen werden und sich auch elektronisch anmelden sowie ihr Stimmrecht online ausüben. Dadurch ergäben sich gerade für größere Firmen erhebliche Kosteneinsparungen, fügt Schmidt hinzu. Denn der teurere Umweg über die Depotbanken entfällt.
Als weiteren Vorteil der Namensaktien nennen Experten die mögliche Abwehr gegen unerwünschte Übernahmen. Wer ein Aktionärsregister hat, kann Veränderungen in der Aktionärsstruktur frühzeitig erkennen und das Anschleichen eines potenziellen Firmenkäufers bemerken, meint Schmidt von Adeus. Namensaktien seien hier klar im Vorteil gegenüber Inhaberaktien.
Tjark Schütte aus dem Investor-Relations-Team der Deutschen Post räumt ein, dass die Schlacht um Mannesmann vor knapp 14 Jahren eine maßgebende Rolle bei der Entscheidung der Post für die Namensaktie gespielt habe. Denn unter den Managern habe damals die Einschätzung geherrscht, dass Mannesmann mit Namensaktien besser gerüstet gewesen wäre im Abwehrkampf gegen Vodafone.
Momentan habe der Einsatz der Namensaktien als Schutzinstrument keine ganz große Bedeutung, meint Marktanalyst Heino Ruland. Denn aufgrund des schwachen deutschen M&A-Geschäfts sei die Übernahmegefahr gesunken.
So geht es den meisten Firmen, die sich für Namensaktien entscheiden, eher ganz pragmatisch um mehr Transparenz gegenüber den Aktionären und die Durchsetzung von Mehrheiten auf den Hauptversammlungen. Da die Zustimmung von 75 % für HV-Beschlüsse wie Kapitalerhöhungen immer schwieriger werde, könne die direkte Kommunikation mit den Anteilseignern über Namensaktien helfen, glaubt Immo von Homeyer, Leiter der Kapitalmarkt- und Unternehmenskommunikation von DIC Asset.
Bei einer Podiumsdiskussion auf der Jahreskonferenz des Deutschen Investor-Relations-Kreises (DIRK) diskutierte Homeyer mit anderen IR-Vertretern über die Frage „Namensaktien – lohnt sich der Aufwand?“ Während Homeyer positive Erfahrungen mit dem Instrument machte und unter anderem erfuhr, dass DIC Asset einen höheren Anteil an Privatanlegern besitzt als vorher angenommen, hielt Regina Wolter von Indus den Aufwand für zu hoch. Nachdem der zentrale Großaktionär von Indus ausgestiegen war, beschäftigte sich die Beteiligungsgesellschaft mit der möglichen Umstellung auf Namensaktien, um herauszufinden, wo die Anteile gelandet sind. Da aber vermutet wurde, dass viele ausländische Anteilseigner die Pakete übernommen haben, sei man bei den Inhaberaktien geblieben. Schließlich seien ausländische Fonds schwer über Aktienregister zu ermitteln.
Tatsächlich bewegen sich viele Firmen bei ausländischen Aktionären im Graubereich. Gerade institutionelle Anleger aus dem Ausland würden sich oft nur über Platzhalter eintragen, sodass die Konzerne nicht zu den wahren Eigentümern vordringen, klagte Oliver Maier, IR-Leiter von Fresenius Medical Care, auf der DIRK-Konferenz.
Manager Schmidt vom Aktienregisterführer Adeus kennt diese Probleme, sieht aber durchaus Fortschritte bei der Einbindung ausländischer Anteilseigner. „Wir sind auf einem guten Weg, auch die ausländischen Aktionäre zu registrieren, insbesondere größere Institutionelle.“ Hilfreich seien die Vorschläge der EU-Kommission zur Überarbeitung der EU-Aktionärsrechte-Richtlinie. Sie soll es Emittenten ermöglichen, ihre Aktionäre leichter identifizieren zu können. Dadurch soll auch die grenzüberschreitende Ausübung von Stimmrechten erleichtert werden. In angelsächsischen Ländern läuft die Identifizierung der „wahren“ Aktionäre bereits per Auskunftsverlangen.
Irgendwann kann sich Schmidt vorstellen, werde es auch in Deutschland nur noch Namensaktien geben. Bis aber die Inhaberaktien verschwinden, dauert es noch viele Jahre. Sie genießen ein hohes Ansehen wegen des bereits langjährig etablierten und sehr effizienten Abwicklungssystems. Auf Dauer hätten sie aber Nachteile im Hinblick auf die Transparenz, meint Schmidt.