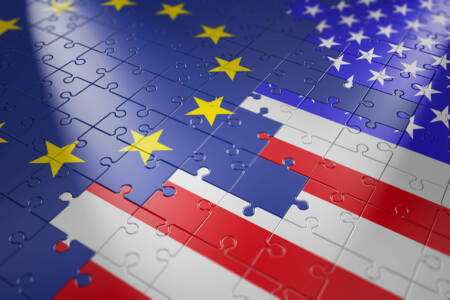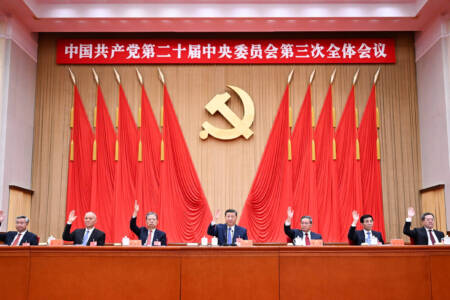20 Jahre Eurobargeld
Am 1. Januar 2002 konnten 300 Mio. Bürgerinnen und Bürger aus 12 EU-Staaten erstmals mit der Gemeinschaftswährung Euro bezahlen. Sie hat sich in den vergangenen 20 Jahren bewährt.

Foto: imago images /Ulmer
Seit dem 1. Januar 2002 zahlen die Bürger – mittlerweile in 19 europäischen Ländern – in Euroscheinen und klingenden -münzen. Grund genug, um die Entwicklung der Währungsunion allgemein zu beleuchten:
Der Grundstein für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion wurde bereits am 7. Februar 1992 mit der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht durch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft gelegt. Im Dezember 1995 wurde der europäischen Gemeinschaftswährung der Name Euro gegeben – auf Vorschlag des damaligen deutschen Finanzministers Theo Waigel. „Euro“ lasse sich in allen Sprachen der EU gut aussprechen und stehe für die Gemeinsamkeit aller Europäer, entschied der Europäische Rat.
Mehr Handel, höhere Wirtschaftsleistung, mehr Wohlstand
Der Euro wurde zunächst – im Januar 1999 – als Buchwährung eingeführt. Die teilnehmenden Länder brachten ihre nationalen Währungen in die neue Gemeinschaftswährung ein und verzichteten auf eine eigenständige nationale Geldpolitik; die wurde der Europäischen Zentralbank (EZB) übertragen, die Mitte 1998 in Frankfurt am Main gegründet worden war: „in einer Stadt mit einer großen Tradition der Währungsstabilität in Europa“, wie der damalige Präsident der Deutschen Bundesbank Hans Tietmeyer ergänzte. Die geldpolitischen Entscheidungen trifft der EZB-Rat, der sich aus der EZB-Präsidentin bzw. dem -Präsidenten und den fünf weiteren Mitgliedern des EZB-Direktoriums sowie den Chefs der nationalen Zentralbanken zusammensetzt.
Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl sah den Euro als „ein Synonym für Europa“ und betrachtete die Gemeinschaftswährung als „eine einzigartige Chance für das friedliche Zusammenwachsen Europas“.

Für die Schaffung des Euro sprachen aber nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Erwartungen: Schon wissenschaftliche Forschungen belegten, dass eine gemeinsame Währung zu einem deutlichen Anstieg des Handels und damit zu höherer Wirtschaftsleistung und mehr Wohlstand führt. Innerhalb der Gebiets der gemeinsamen Währung entfällt der Geldumtausch und Preisvergleiche sind unproblematisch. Aufgrund entfallender Wechselkursschwankungen können Unternehmen Kosten und Erlöse beim Handel mit Gütern und Dienstleistungen sicherer kalkulieren, was Investitionen und Wachstum fördert. Ferner ist mit dem Euro eine weitere globale Währung geschaffen worden, die in Krisenzeiten Sicherheit suchendes internationales Kapital anzieht. So geschehen in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 bis 2009, was auch der Eurozone geholfen hat, die Konsequenzen der Krise zumindest etwas abzufedern.
Euro übersteht Finanzkrise 2008 und Griechenlandkrise 2010
Die Vorteile einer Gemeinschaftswährung zeigten sich in den ersten zehn Jahren des Euro: Sie schafften die Grundlage für eine gute wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum. Vor allem die ärmeren südeuropäischen Euroländer erfreuten sich eines unerwartet hohen Kapitalzustroms. Zudem drückten die erheblichen Kapitalzuflüsse die Zinsen in den südlichen Euroländern auf nie gekannte niedrige Niveaus, was auch die Investitionen und den Konsum der einheimischen Unternehmen und Bevölkerung beflügelte. Allerdings stiegen auch die staatliche und private Verschuldung sowie die Leistungsbilanzdefizite im Süden der Eurozone kräftig an.
Mit Beginn der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, die von den USA ausging, verschlechterte sich die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum. Das deutsche Budgetdefizit lag über der im Maastricht-Vertrag festgelegten 3 %-Grenze. Dass dies keine Sanktionen nach sich zog, bereitete Skeptikern schon damals „Sorgen um die Stabilitätskultur“ im Euroraum. Die Krise traf die immer noch auf wirtschaftlich schwächerer Basis stehenden und hoch verschuldeten südlichen Eurostaaten besonders hart. Insbesondere Griechen, Spanier und Portugiesen hatten mehr konsumiert als produziert und mehr importiert als exportiert.
Geblieben war eine Verschuldung der südlichen Euroländer, die weit über die im Maastricht-Vertrag festgelegten Grenzen hinausging sowie deutliche Leistungsbilanzdefizite. Griechenland konnte 2010 seine Schulden nicht mehr aus eigener Kraft zurückzahlen. Die „No-Bail-out-Klausel“ im Maastricht-Vertrag – wonach kein Euroland für ein anderes finanziell haftet – verletzend, wurde das erste Rettungspaket für Griechenland geschnürt – weitere folgten.
Das beruhigte die Gläubiger indes nicht. Im Gegenteil, auch andere Euroländer wie Irland, Portugal, Spanien oder Italien wurden von der Verunsicherung der Märkte erfasst und der Zusammenbruch der Währungsunion war zu befürchten. Es mehrten sich die Stimmen, die sagten, dass eine Währungsunion ohne politische Union, die sich vor allem an den stärksten Mitgliedstaaten orientiere, zum Scheitern verurteilt sei. Als im August 2011 selbst Frankreich von der Panik erfasst wurde und im Mai 2012 die griechische Parlamentswahl im Chaos endete und die Schieflage der spanischen Großbank Bankia einen weiteren kräftigen Börsenrutsch auslöste, signalisierte der damalige EZB-Präsident Mario Draghi mit den Worten „Whatever it takes“, wer Ländern wie Spanien oder Italien Geld leihe, brauche keine Angst zu haben, die EZB werde deren Staatsanleihen stets zurücknehmen. Mit unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen öffnete die EZB die Geldschleusen weit und die Zinsen wurden auf 0 % und darunter gedrückt. Zwar gelang es, die Eurowirtschaft wieder zu stimulieren und die Finanzmärkte zu befeuern, aber die reichlich fließenden Mittel vermochten es nicht, die hoch verschuldeten Eurostaaten in ausreichendem Maße zu wirtschaftsstabilisierenden Reformen und zum Schuldenabbau zu bewegen. Die Coronakrise hat schließlich die Verschuldungen auf neue Höchststände getrieben. So hoch, dass es die EZB heute nicht wagt, die sich mit kräftigen Wachstumsraten zurückmeldende Inflation wie notwendig mit einer streng restriktiven Geldpolitik zu bekämpfen.
Maastricht-Kriterien zur Eurostabilität nicht mehr einzuhalten
Trotz all der Querelen in der Währungsunion hat sich der Euro bis heute jedoch einen festen Platz im Konzert der Weltwährungen gesichert. In den letzten Jahren ist der Euro in seiner Rolle als internationale Währung aber nicht mehr stärker geworden. Der Dollar ist nach wie vor Weltwährung Nr. 1 und die wichtigste Reservewährung.
Eine Diskussion über Reformen des Vertragswerkes ist in Gang gekommen. So trafen sich jüngst die Regierungschefs von Frankreich und Italien, Emmanuel Macron und Mario Draghi. Die Gespräche dienten der Vorbereitung der französischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar 2022 beginnt. Mit Blick auf die Währungsunion teilen Macron und Draghi die Ansicht, dass die wegen der Pandemiekosten ausgesetzten Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts nicht mehr der Realität in der Gemeinschaft entsprechen.
Frankreich überschreitet die im Maastricht-Vertrag festgesetzte maximale Grenze der Gesamtverschuldung in Höhe von 60 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) mit etwa 115 % erheblich. Italien kommt sogar auf ca. 155 %. Beide Länder werden die vorgeschriebenen maximal 60 % Gesamtverschuldung auf Sicht nicht erreichen. Ein Versuch Frankreichs und Italiens gemeinsam die Schuldenregeln aufzuweichen, liegt nahe. So wird z. B. erwogen, Zukunftsinvestitionen in die Wirtschaft nicht mehr auf die Grenze von 3 % beim Haushaltsdefizit anzurechnen, wie im Maastricht-Vertrag vorgeschrieben.
Spannend werden die Reformbemühungen mit Blick auf die neue Bundesregierung. Die Ampelkoalitionäre SPD und Grüne könnten sich den angedachten Reformen gegenüber offener zeigen. Doch FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner betont laufend, dass die Währungsunion zu keiner Schulden- und Transferunion werden darf.