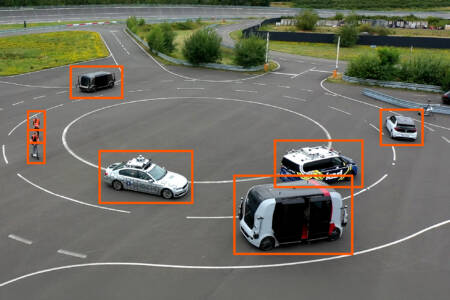Bernd Greiner über das Scheitern der USA nach dem 11. September 2001
Der Historiker Bernd Greiner beschreibt die Konsequenzen aus dem Ende der US-Hegemonie und die Folgen für die deutsche Außenpolitik.

Foto: ddp
VDI nachrichten: Herr Greiner, in Ihrem Buch „9/11“ schrieben Sie vor zehn Jahren: „Taliban und al-Qaida in Afghanistan das Feld zu überlassen, würde das überparteiliche Konzept amerikanischer Weltmachtpolitik im Kern treffen: Durchsetzungsfähigkeit, Behauptungswille und Führungskraft.“ Wie stark trifft der Rückzug aus Afghanistan diesen Kern?
Greiner: Die drei Begriffe sind Synonyme für das, was US-Außenpolitik seit Jahrzehnten ausmacht: Die Herstellung von Glaubwürdigkeit, die im amerikanischen Verständnis von Hegemonialpolitik in erster Linie verknüpft ist mit militärischer Stärke, mit der Androhung und Durchsetzung von Gewalt. Nun haben die USA in Afghanistan und im Irak wie zuvor in Vietnam die Erfahrung machen müssen, dass diese Instrumente gegen Guerillakämpfer stumpf sind. Dieses Scheitern fügt der US-Soft-Power immer wieder schweren Schaden zu. Aus meiner Sicht läuten die Rückzüge aus dem Irak und Afghanistan das Ende der amerikanischen Hegemonie ein.
Mit der bisherigen US-Hegemonialpolitik sind die internationalen Herausforderungen nicht zu bewältigen
Was tritt an ihre Stelle?
Das ist schwer zu prognostizieren. China ist eine Hegemonialmacht im Wartestand. Wie sich internationale Beziehungen entwickeln werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sich die EU und Deutschland verhalten. Sicher ist, dass mit den von den USA präferierten Mitteln die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht zu bewältigen sind. Wir müssen einen außenpolitischen Weg einschlagen, auf dem wir nicht eine Sprache der Gewalt lernen, sondern eine Grammatik des Vertrauens einstudieren. Die Logik dieser Politik kennen wir noch sehr gut aus der Vergangenheit, nämlich die Entspannungspolitik der 1970er-Jahre, betrieben in der Bundesrepublik von Willy Brandt, in Schweden von Olof Palme und in Österreich von Bruno Kreisky. Diese Politik beruht auf der Einsicht, dass man Interessen nicht mit Brachialgewalt durchsetzt, sondern Interessen ausgleicht. Und in Vertrauen investiert, ohne die Gewissheit zu haben, dass es zu den erwünschten Ergebnissen führt. Aber ohne diesen Vertrauensvorschuss sowohl für China wie für Russland wird man nicht bewerkstelligen können, was allenthalben als Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte beschrieben wird, also Klimapolitik, Schutz vor Pandemien und Ähnliches. Diese Probleme verlangen eine globale Kooperation und eine verbale und ideologische Abrüstung.

Orientierung an der Entspannungspolitik von Willy Brandt
Allerdings hat Willy Brandt damals aus einer Position der Stärke agiert, fest eingebunden in die Nato und in einer Phase der massiven Modernisierung der Bundeswehr. Ist eine solche Politik in der aktuellen Situation noch möglich?
Die Entspannungspolitik hat ja nicht funktioniert, weil die Bundesrepublik über eine schlagkräftige Armee verfügte. Entscheidend war, dass Willy Brandt und seine Nachfolger sich nie auf militärische Stärke als Grundvoraussetzung ihrer Politik bezogen haben. Stärke hieß im Verständnis von Brandt stets Diplomatie.
Ist der skizzierte Vertrauensaufbau in einer multipolaren Welt schwieriger, weil jede Verständigung zwischen zwei Parteien zwangsläufig auf Kosten Dritter geht?
Sicher erschwert Multipolarität jeden Versuch eines Interessenausgleichs. Ich sehe jedoch keine überzeugende Alternative zur Investition in Vertrauen. Es gibt kein anderes Angebot im politischen Portfolio, das in der Vergangenheit geklappt hat und als Inspiration für die Zukunft wirkt.
Eine Ihrer zentralen Thesen lautet, mit den Anschlägen des 11. September sei die Angst ins öffentliche Leben zurückgekehrt. Seitdem gab es eine ganze Reihe tiefer Krisen, etwa den weltweiten Terror des Islamischen Staates (IS). Gibt es Chancen, diese Angst aus dem öffentlichen Leben zu bannen?
Ja. Vorausgesetzt, der Westen betreibt eine belastbare Kooperationspolitik auch mit jenen Staaten, die nicht unsere Werte teilen. Die Chancen schwinden, wenn man glaubt, sich auf Zwangsmittel verlassen zu können. Wenn Sie die letzten 20 Jahre als Gradmesser nehmen, erkennen Sie, wie kontraproduktiv die Reaktionen der USA auf 9/11 gewesen sind. Der Aufstieg des IS war Folge des mit Lügen herbeigeredeten Krieges gegen den Irak. Ursprünglich war jeder zweite IS-Kämpfer ein ehemaliger Soldat der irakischen Armee. Diese fehlgeleitete Politik hat den USA mehr Feinde in der arabischen Welt geschaffen, als sie sie vor dem 11. September ohnehin schon hatten.
„Die Polarisierung des öffentlichen Lebens hat zum Aufstieg von Donald Trump beigetragen.“
Ihr Buch enthält deprimierende Darstellungen, wie in den USA Demokratie, Grundrechte und Gewaltenteilung beschnitten wurden. Hat es Sie erstaunt, dass die Institutionen der US-Demokratie die Amtszeit von Donald Trump einigermaßen glimpflich überstanden haben?
Das öffentliche Leben ist sicher nicht komplett ruiniert, sonst hätten wir es mit einer Autokratie zu tun. In meinem Buch habe ich den Prozess einer schleichenden Schwächung der demokratischen Institutionen beschrieben, insbesondere die der Gewaltenteilung. Die damit verbundene Polarisierung des öffentlichen Lebens hat zum Aufstieg von Donald Trump beigetragen und der demokratischen Verfassung des Landes nicht gutgetan. Wie der Sturm auf das Kapitol im Januar gezeigt hat, ist hier keine Entwarnung angesagt.
Die Anschläge vom 11. September 2001 zeigten die Verletzlichkeit der USA
Gibt es einen Zusammenhang zwischen 9/11 und dem Aufstieg von Donald Trump?
Trump hat aus Emotionen und rassistischen Ressentiments politisches Kapital geschlagen, aus Faktoren also, die weit über 9/11 hinausweisen. Dazu zählt der Ruin des amerikanischen Traums, mithin des Versprechens, dass es jeder Generation besser gehen wird als der vorherigen. Ebenso sind der ökonomische Abstieg der USA und die brachiale neoliberale Wirtschaftspolitik seit den 1980er-Jahren verantwortlich, die verwüstete Landschaften besonders im Nordosten und im mittleren Westen hinterlassen haben. Aus dieser Enttäuschung hat Trump mit seiner völlig verantwortungslosen Politik der Spaltung seinen Honig gezogen. Das alles hat mit 9/11 relativ wenig zu tun. Allenfalls trug zu Trumps Aufstieg der sich nach den Terroranschlägen verdichtende Eindruck bei, die USA seien nicht nur innenpolitisch auf dem absteigenden Ast, sondern als stärkste Militärmacht der Welt auch verletzlich gegenüber Angreifern, die mit Teppichmessern hantieren.
In Ihrem Buch schreiben Sie, 9/11 habe den Trend beschleunigt, dass Meinungen und Gefühle wichtiger würden als Fakten. Zu den Anschlägen gibt es unzählige Verschwörungstheorien. Inwiefern sind die Coronaquerdenker die Erben von 9/11?
Der Aufstieg von Verschwörungstheorien gehört in der Tat zu den langfristigen und schwer kalkulierbaren Konsequenzen. Verschwörungstheorien gibt es seit Hunderten von Jahren. Seit dem 20. Jahrhundert nahmen sie zu, weil die Welt, in der wir leben, immer undurchsichtiger wird, und es für deren Probleme keine einfachen Lösungen mehr gibt. Damit steigt die Versuchung, durch schlichte Antworten eine undurchschaubare Welt durchsichtig zu machen, indem man alle Übel auf eine einzige Wurzel reduziert – beispielsweise auf das angeblich maliziöse Treiben der Juden. Donald Trump hat diesen Fantasien eine weitere hinzugefügt, nämlich den sogenannten deep state, dessen Eliten angeblich im Verborgenen und auf Kosten der kleinen Leute die Fäden ziehen. Aber auch für diese Konjunktur von Verschwörungstheorien gibt es Ursachen, die über den 11. September hinausweisen. Insbesondere spielen die von der Globalisierung ausgelösten Ängste eine Rolle: Wo ist unser Platz in der Welt? Haben wir als Nationalstaat überhaupt die Möglichkeit, steuernd einzugreifen? Oder sind wir anonymen Akteuren in der Finanzwelt ausgeliefert, die keine Adresse und keine Telefonnummer mehr haben?
„Was mir zudem Sorgen bereitet, sind Bidens an die Rhetorik des Kalten Kriegs erinnernden Einlassungen zu China.“
Laut der vorläufigen Nationalen Sicherheitsstrategie wollen sich die USA auf die Rückgewinnung ihrer inneren Stärken konzentrieren. Ist das ein richtiger Schritt?
Die Welt kann von prosperierenden USA nur profitieren. Es wäre der blanke Wahnsinn zu erwarten, dass eine tiefe innenpolitische Krise in den USA für andere Staaten von Vorteil wäre. Bidens Entscheidung, irrwitzige Summen in die Infrastruktur zu investieren, war richtig, weil diese Investitionen dringend notwendig sind. Er setzt damit die USA keineswegs auf ein neues Gleis. Es wäre lediglich eine Rückkehr zum Status quo ante der 1950er-Jahre mit funktionierender Infrastruktur aus Brücken, Eisenbahnlinien und Wasserstraßen. Diese Infrastruktur haben so gut wie alle Regierungen seit den frühen 1980er-Jahren im Zeichen des Neoliberalismus mit Vorsatz vernachlässigt. Offenbar will Biden die notwendigen Investitionen aber nicht auf Kosten der Rüstungsausgaben finanzieren. Was mir zudem Sorgen bereitet, sind Bidens an die Rhetorik des Kalten Kriegs erinnernden Einlassungen zu China. Die Sowjetunion war ein schwacher Konkurrent. China dagegen ist ein starkes, ein wirtschaftlich aufstrebendes Land, das in vielen Bereichen mit den USA konkurrieren kann. Biden ist schlecht beraten, gegenüber einer solchen Macht eine Rhetorik der Konfrontation zu pflegen.
Es war ein Fehler, dass sich die Bundeswehr am Afghanistan-Einsatz beteiligte
Anlässlich des Abzugs aus Afghanistan sagte Biden, Nation Building sei dort nie das Ziel gewesen. Nun wurde der Bundeswehreinsatz stets mit Nation Building verknüpft. War es von Anfang an ein Fehler, dass sich Deutschland in Afghanistan engagierte?
Was die Regierung von George W. Bush, die bis Anfang des Jahres 2008 amtierte, in Afghanistan und im Irak betrieben hat, war eine knallharte, auf militärische Macht gegründete Politik, um den Rest der Welt, insbesondere den arabischen Teil, einzuschüchtern und allen zu signalisieren: Wer sich mit uns anlegt, riskiert sein Überleben. Nation Building war wenig mehr als parfümierter Qualm, ein Schlagwort, um eine Koalition der Willigen zu schmieden und Regierungen wie die der Bundesrepublik, die sonst kein innenpolitisches Votum bekommen hätten, für eine reine Militärmission zu gewinnen. Ein ranghoher französischer Offizier hat schon vor zehn Jahren mit Blick auf die militärische Kommandoaktion der US Army, mit Blick auf die nächtlichen Razzien und den Drohnenkrieg gesagt: Mit jedem Tag, an dem wir diese Einsätze dulden, schaffen wir uns Hunderte neuer Feinde. Genau so ist es gekommen. Es war ein Fehler, sich an dieser Mission zu beteiligen. Die ablehnende Haltung zum Irakkrieg hätte die damalige Bundesregierung auch nutzen sollen, um sich aus Afghanistan zurückzuziehen.
„Man kann auch transatlantische Solidarität üben, indem man massive Kritik an einem einmal eingeschlagenen außenpolitischen Kurs übt
Wann wäre die Gelegenheit gewesen, diesen Fehler zu korrigieren?
Das ist schwer zu sagen, weil die Verantwortlichen unweigerlich in einen Prozess geraten, der seine eigene Dynamik entfaltet und der schwer zu korrigieren ist. In den USA gibt es dafür den Begriff des „Mission Creep“, für eine sich hinter dem Rücken der Akteure entfaltenden Logik, nach der der Preis für das Beenden einer Mission höher ist als der für das Weiterführen. Die Bundesregierungen haben das Afghanistanengagement im Laufe der Zeit heruntergefahren, haben versucht, es schleichend und gesichtswahrend zu reduzieren. Was mir immer noch fehlt, ist eine ehrliche Bestandsaufnahme, wie sie etwa die norwegische Regierung vorgelegt hat, also einen ungeschminkten Erfahrungsbericht darüber, was man erreicht und insbesondere was man nicht erreicht hat und was die Ursachen dafür sind.
Bei uns verschanzt sich die Regierung immer noch allzu sehr hinter dem Argument: „Wir müssen transatlantische Solidarität üben. Dazu gibt es keine Alternative.“ Man kann aber auch transatlantische Solidarität üben, indem man massive Kritik an einem einmal eingeschlagenen außenpolitischen Kurs übt. Auch das ist eine Lehre aus der Entspannungspolitik der 1970er-Jahre. Die Bundesrepublik kann selbstständig Außenpolitik betreiben, ohne das ethische Fundament der Westbindung zu beschädigen.
In den Rückblicken auf das deutsche Afghanistanengagement wird immer wieder auf Erfolge verwiesen: Stärkung der Frauenrechte, Aufbau eines Bildungswesens, etc. Wäre es vertretbar gewesen, nach drei Jahren wieder abzuziehen?
Das ist die falsche Alternative. Wir können uns in anderen Ländern für Menschenrechte, für den Aufbau einer Zivilgesellschaft engagieren. Wir können das zarte Pflänzchen der Demokratie wässern. Aber in dem Moment, wo diese Versuche untrennbar mit einer militärischen Invasion verbunden sind, ruinieren wir, was wir zu schützen vorgeben. Genau diese Politik hat die Taliban wieder an die Macht gebracht.