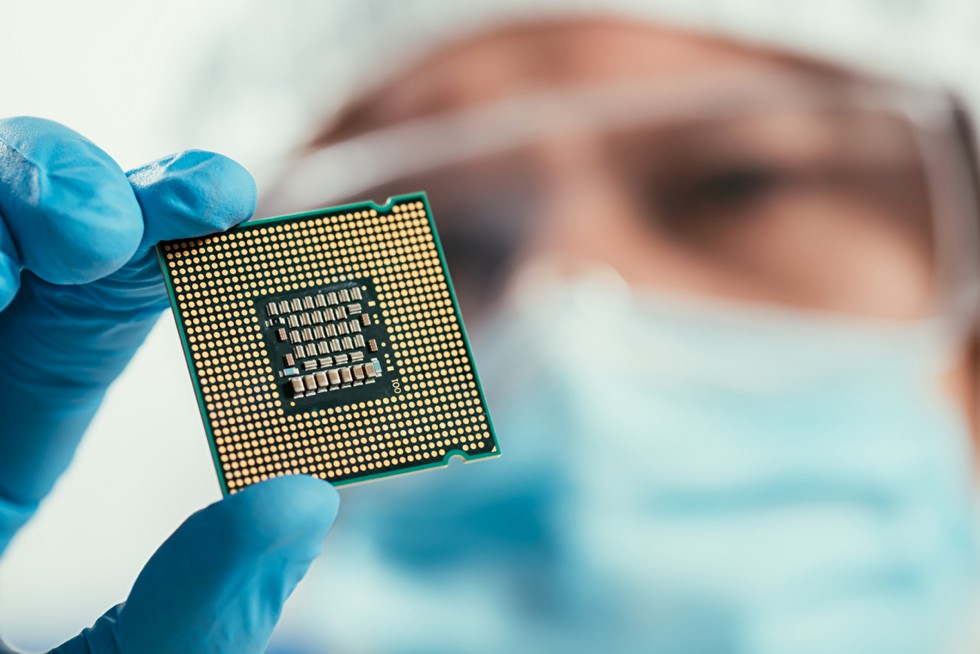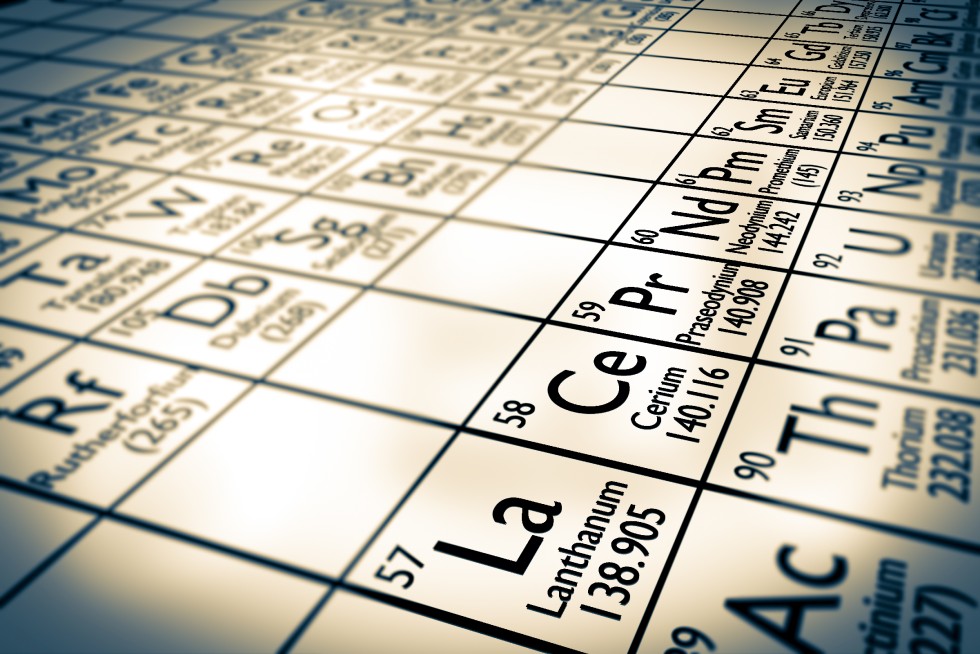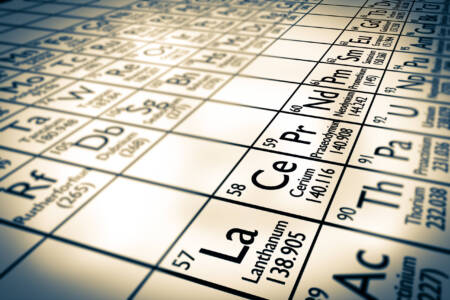Metall aus dem Meer
Die Zukunft der Industrie liegt im Pazifik und im Indischen Ozean. Während an Land die Metalllagerstätten zur Neige gehen, liegen in den Meeren noch Schätze verborgen: Eisen und Kupfer warten am Meeresgrund darauf, gehoben zu werden. Doch bis hier aus dem Vollen geschöpft werden kann, bedarf es noch vieler findiger Ingenieure.

Foto: BGR
Zu fast 100 % ist die deutsche Wirtschaft bei Metallen von Importen abhängig. Ob Kupfer aus Peru, Seltene Erden aus China oder Platin aus Südafrika, die heimische Produktion benötigt Ressourcen aus aller Welt. Denn zu Hause sind kaum Metalle zu finden oder nicht wirtschaftlich abbaubar. Dabei hängt die heimische Industrie am Rohstoff-Tropf einiger wenigen Länder, was die deutschen Konzerne in der Vergangenheit schon des Öfteren in Bedrängnis brachte. So haben z. B. Streiks von Bergleuten in Südafrika, wo über 80 % der weltweiten Platinreserven liegen, in den letzten Monaten immer wieder zu starken Preisanstiegen bei dem Edelmetall geführt. Und als sich China, das für knapp 97 % der Selten-Erde-Produktion verantwortlich ist, vor wenigen Jahren dazu entschied, weniger der Hightech-Metalle zu exportieren, explodierten die Preise.
Dabei verteuern nicht nur einmalige externe Effekte einzelne Metalle. Vor allem der wachsende Rohstoffhunger von Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien treibt die Nachfrage und damit auch die Preise. Im Durchschnitt stiegen in den letzten zehn Jahren die Importkosten jährlich um 12,2 %, während die Menge im gleichen Zeitraum pro Jahr um lediglich 0,1 % zunahm. So rechneten die Experten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in ihrem letzten Rohstoffbericht.
Die Lösung des Problems ist eigentlich ganz einfach: Wer über keine eigenen Rohstoffquellen verfügt, der muss sich welche besorgen. Ist das Bundesgebiet nicht gerade mit Metalllagerstätten verwöhnt und neigen sich die weltweit bekannten Reserven einiger Metalle dem Ende zu, liegen in den Meeren noch wahre Schätze:
Manganknollen bedecken viele Tausend Quadratkilometer des Tiefseebodens. Die kartoffel- bis salatkopfgroßen Knollen enthalten, wie der Name sagt, vor allem Mangan, aber auch Eisen, Nickel, Kupfer, Titan und Kobalt. Und das teilweise in einer Konzentration, wie sie an Land nicht zu finden ist. Aber auch Platin, Seltenerdoxide, Lithium und viele weitere Metalle sind in einem geringeren Maße in ihnen enthalten. Wirtschaftlich interessante Vorkommen sind vor allem im Pazifik, im Indischen Ozean sowie in den weiten Tiefseeebenen in Meerestiefen von 3500 m bis 6500 m zu finden. Das Entstehungsprinzip der Manganknollen ist denkbar einfach. Im Meerwasser gelöste Metallverbindungen lagern sich nach und nach an z. B. einem Haifischzahn oder einem Muschelsplitter ab und bilden so eine Knolle. In der Clarion-Clipperton-Zone, dem mit 9 Mio. km2 weltweit größten Manganknollengebiet, liegen sie dicht an dicht. So finden sich durchschnittlich 15 kg der metallreichen Knollen pro m2 Meeresgrund in der Pazifikregion, die sich von der Westküste Mexikos bis nach Hawaii erstreckt.
Metallreiche Krusten sind steinharte metallhaltige Beläge, die sich auf den Felshängen von untermeerischen Vulkanen, sogenannten Seebergen, bilden. Sie entstehen ähnlich wie Manganknollen, indem sich im Laufe von Jahrmillionen Metallverbindungen im Wasser auf dem Gestein ablagern. Auch in ihnen ist eine ganze Palette an Metallen zu finden. Insbesondere aber enthalten die 2 cm bis 26 cm dicken Schichten Kobalt, Nickel und Mangan. Die Kobaltkrusten sind in Tiefen von 600 m bis 7000 m zu finden. Untersuchungen an Seebergen haben gezeigt, dass sich die dicksten und wertstoffreichsten Krusten im oberen Bereich der Seeberghänge sitzen,da diese gut angeströmt werden. Anders als bei den Manganknollen, die einfach vom Meeresgrund aufgelesen werden können, sind die Kobaltkrusten fest mit dem felsigen Untergrund verbunden. Wer an ihre metallischen Schätze will, muss sie erst mal vom Untergrund ablösen.
Massivsulfide sind metallhaltige Schwefelverbindungen, die sich an und um die heißen Quellen ablagern. Und das geschieht so: Durch Spalten am Meeresboden dringt Wasser mehrere Tausend Meter tief in den Untergrund ein. Hier wird es durch vulkanische Aktivität auf bis zu 400 Grad aufgeheizt und löst Metalle und Schwefel aus dem umgebenen Vulkangestein. Da das heiße Meerwasser eine geringere Dichte als das kühlere Wasser darüber hat, steigt es schnell auf und fließt zurück ins Meer. Dabei verbinden sich die im Wasser gelösten Metalle zu feinen Sulfidpartikeln und sinken als feiner Niederschlag zu Boden. An vielen Hydrothermalquellen haben sich so die Sulfide an den Austrittsstellen zu mehreren Meter hohen schornsteinartigen Strukturen aufgetürmt. Das Wasser schießt wie eine Fontäne aus den Röhren ins Meer. Dabei lagert sich nach und nach weiteres Material um die Röhren ab. Je nachdem welche Mineralien aus dem Boden gelöst werden, strömt das Wasser weiß oder schwarz gefärbt aus den Schornsteinen. Die Strukturen werden aufgrund ihres Aussehens dann auch als schwarze oder weiße Raucher bezeichnet.
Fazit: Eine Vielzahl an Metallen liegt in der Tiefsee. Erforscht werden und wurden sie bereits von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Deren Experten haben sich im Auftrag des Wirtschaftsministeriums auch schon bei der zuständigen internationalen Behörde Lizenzen für die Exploration geholt. Ein Manganknollenfeld im Pazifik haben sie untersucht und machen sich nun auf, Schwefelsulfide im Indischen Ozean zu explorieren. Mit diesem Wissen und den zugehörigen Lizenzen könnte so eines Tages ein deutsches Unternehmen die Schätze aus der Tiefsee bergen und auch die deutsche Industrie versorgen.
Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wie genau die Rohstoffe geborgen werden sollen, darüber gibt es bisher nur Visionen und Versuchsprojekte. Die sich stellende Herausforderung ist gigantisch. In solchen Tiefen haben Bergungsmaschinen neben dem Salzwasser auch mit Strömungen, Dunkelheit und vor allem immensen Drücken zu kämpfen. Bis die Metalle aus dem Meer ihren Weg in deutsche Produkte finden, bedarf es noch der Entwicklungsleistung vieler findiger Ingenieure. Dass dies aber kein Hirngespinst ist und die Metalle durchaus wirtschaftlich abgebaut werden können, davon sind die Geologen der BGR auch heute schon überzeugt.
CHRISTOPH BÖCKMANN
Kommentar: In der Tiefsee drängt die Zeit
Rund 400 000 km sind Erde und Mond im Durchschnitt voneinander entfernt. Gerade einmal 4 km unter der Oberfläche der Weltmeere erstrecken sich gigantische Rohstoffvorkommen. Hunderte Milliarden Euro, wenn nicht sogar einige Billionen ließen sich nach Expertenschätzungen mit den Metallen und Mineralien der Tiefsee umsetzen. Wenn man sie bloß an Land holen könnte. Für einen Tiefseebergbau sind die Rohstoffe heute allerdings noch unerreichbar. Fast so unerreichbar, als lägen sie auf dem Mond. Der Knackpunkt ist die Fördertechnik. Ohne ein funktionierendes System kein Bergbau. Die Anforderungen allerdings, sie sind enorm. In 4 km Tiefe herrscht ein Druck von 400 bar, das ist das 400-Fache des Druckes an der Wasseroberfläche. An den Lagerstätten der Manganknollen und Massivsulfide ist es außerdem stockfinster. Jede Lichtquelle, auf die ein Roboter angewiesen sein könnte, für optische Sensoren etwa, muss erst auf den Meeresgrund gebracht werden. Dort wäre das Bergbauequipment weit über 200 Tage im Jahr dem Salzwasser ausgesetzt. Es bräuchte den richtigen Materialmix, um zu verhindern, dass die teuren Geräte korrodieren. Und selbst wenn es gelänge, die richtige Infrastruktur unter Wasser zuverlässig bereitzustellen – es ergäben sich einige ganz praktische Probleme, wenn ein Roboter eine Manganknolle greift. In vielen Regionen gibt es starke Strömungen in Bodennähe.
Woran aber festhalten, wenn der Untergrund aus Schlamm und lose aufliegenden Knollen besteht?
Entscheidend ist auch die Frage, wie mit dem Tiefseegerät kommuniziert werden kann. Viele der Kommunikationswege, die sich an Land und in der Luft, ja sogar im Weltraum bewährt haben, scheiden von vornherein aus. Beispiel Funk: Wasser absorbiert die elektromagnetische Strahlung und setzt sie in Wärme um. Das Funksignal käme also gar nicht erst an. Drei Auswege bleiben. Der erste bestünde darin, völlig neue Kommunikationssysteme zu entwickeln, etwa über Schall. Forscher halten diese Form der Telemanipulation aber für unpraktikabel. Der zweite Weg: Kommunikation über ein Kabel. Über die Glasfaser könnten Daten problemlos zwischen dem Abbaugerät in der Tiefe und dem Leitstand an der Oberfläche hin und her wandern. Wenn da nicht der Staub wäre. Denn wo abgebaut wird, entstehen abrasive Partikel, die die Kabel anrasieren. Der dritte Weg ist zugleich der simpelste: Es wird überhaupt nicht kommuniziert. Er führt in die Autonomie. Die Betreiber müssen den Kommunikationsbedarf gering halten, einmal abgetaucht wäre das Abbaugerät auf sich allein gestellt. Hohe Belastungen, erschwerte Kommunikation, kaum Erfahrung mit Unterwasserbergbau: Angesichts der Probleme ist es kein Wunder, dass für manchen Forscher die Tiefsee weiter weg ist als der Mond.
Muss man erwähnen, dass die Umweltverträglichkeit eines Tiefseebergbaus keinesfalls geklärt ist?
Die Herausforderung der nächsten Jahre wird erstens sein, Komponenten zu entwickeln, die all diesen Widrigkeiten trotzen können. Und zweitens wird sie darin bestehen, diese Komponenten zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzufügen. Wer aber soll das für Deutschland tun? Sicher, es gibt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Was es aber nicht gibt – und da hinkt Deutschland hinter anderen Nationen wie Indien und Korea her – ist ein Unternehmen, dass all die nötige Forschung in ein technisches System überführt. Deutschland hat nun mal keinen großen Rohstoffkonzern mehr. Das könnte sich noch aus einem anderen Grund negativ auswirken. Denn die mittelständisch geprägten Komponentenlieferanten, Sensorspezialisten etwa, scheuen die anfangs hohen Investitionen in den Tiefseebergbau. In wenigen Jahren laufen die ersten Explorationslizenzen aus und müssen – sollen sie nicht verfallen – in Bergbaulizenzen umgewandelt werden. Die Zeit drängt in der Tiefsee. Ziel muss es deshalb sein, die Hightech-Unternehmen möglichst bald für den Bergbau in 4 km Tiefe zu gewinnen. Dass die hiesigen Firmen wirtschaftliche Lösungen für den Tiefseebergbau finden würden, ist wahrscheinlich. Aber sie brauchen Sicherheit.
Wenn es keinen Großkonzern gibt, liegt es am Staat, ihnen diese Sicherheit zu geben. Oder an Europa. Neben Deutschland besitzen schließlich auch andere europäische Länder wie Frankreich und Großbritannien Explorationslizenzen. Gemeinsam könnten sie an der nötigen Fördertechnik arbeiten. Damit die Tiefsee nicht für immer so weit weg ist wie der Mond.
IESTYN HARTBRICH